|
Storchenkamera

Storchentagebuch 2002
...was bisher geschah
Teil 6
|
|
10. Apr. 02
|
Noch immer ranken sich die Diskussionen der
Tagebuchleser und Gästebuchschreiber vornehmlich um den Zustand
des Nestes.

07.04.02 |
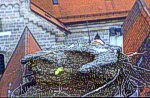
10.04.02 |
Im gestrigen Eintrag habe ich
versucht durch Wort und Bild darzustellen, wie sich unser Nest in
der Vergangenheit zu Beginn der Brutzeit präsentierte und was sich
schließlich daraus entwickelte. Ganz gleich, in welchem Zustand die
Störche das Nest vorfanden, es war in jedem Jahr von einem Paar
besetzt. Niemals wurde die Storchenbehausung seitdem in irgendeiner
Weise von Menschen nachbearbeitet oder nach menschlichen
Ordnungsprinzipien hergerichtet (Ausnahme die Versuche – zuletzt
1993 – vor Beginn der Wiederbesiedelung Dinkelsbühl durch die Störche).
Auch wenn weitere Bereiche des Nestkerns in den nächsten Tagen
abbrechen oder von den Dohlen zum Einsturz gebracht werden, hat dies
– meiner Meinung nach – keinerlei Auswirkungen auf die
Ansiedlungsbereitschaft eines neuen Nestbesuchers. Äste oder Zweige
sind fast gänzlich geschwunden. Ein Gästebucheintrag bezieht sich
auf Versuche, das Dach unter dem Storchennest weiß zu kalken, um so
möglichen überfliegenden Störchen zu signalisieren, dass hier ein
Storchennest sei, das auf Besucher wartet. Ich kenne solche Maßnahmen,
habe sie aber selbst noch nie erprobt, da ich auch von derartigen
Spielereien überhaupt nichts halte. Der erste Besucher unseres
Nestes, er weilte vom 15. Februar bis 16. März ununterbrochen am
Nest, färbte damals das Dach in weitem Umkreis um das Nest
schneeweiß. Von ihm sind auch heute noch immer Spurenreste unter
dem Dach zu erkennen.
|
|
12. Apr. 02
|
Die markante Dohlenpräsenz der letzten
Wochen gehört nun endgültig der Vergangenheit an. Nun sind es
schon eher die Ausnahmen, wenn man einzelne Exemplare der munteren
Rabenvögel für kurze Zeit am Storchennest sieht. Die Dohlennester
unter dem Dach des Münsters St. Georg sind mittlerweile fertig
und die Eiablage hat zum Teil schon begonnen. Also droht in nächster
Zeit aus dieser „Ecke“ keine Gefahr mehr für unser Nest. Das
junge Pflänzchen, das ich im Tagebucheintrag vom 7. April
beschrieben habe, hat sich als nicht genau identifizierbares Plastikteil
entpuppt. Verzeihen Sie Ihrem Schreiber, dass damals die Fantasie
mit ihm durchgegangen ist. Aber wenn schon kein Storch zu
beschreiben ist, klammert man sich auch einmal an einen Strohhalm
(oder an junges keimendes Leben).
An den Ufern der Wörnitz, soweit sie den Landkreis Ansbach von ihrem
Ursprung bei Schillingsfürst bis südlich von Wassertrüdingen
durchfließt, sind in der Zwischenzeit alle Storchenhorste wieder
besetzt mit Ausnahme von Dinkelsbühl.

Schon berichtet habe ich
von den Brutpaaren in Mosbach und in Weiltingen.
Ebenfalls schon mit der Brut begonnen hat das Paar von Gerolfingen,
während das von Wassertrüdingen als vorerst letztes
eingetroffen und noch mit den Vorarbeiten zur Brut beschäftigt ist.

Das Mosbacher Nest auf dem Kamin der
ehemaligen Molkerei vom Kirchturm
aus gesehen |

Das Weiltinger Nest auf einem
still gelegten
Sägewerkskamin |

Nest auf Kamin eines
ehemaligen Brauereigebäudes
in Gerolfingen |

Nest auf Dach eines Lagerhauses
in Wassertrüdingen auf
künstlicher Nisthilfe |
|
|
13. Apr. 02
|
Auch heute ließ sich wieder kein
Storch blicken. Das Wetter verschlechterte sich dafür
zusehends und nach über zwei Wochen
ohne Niederschläge gab es den ersten Regentag seit langem. Für
Störche auf dem Zug bzw. für solche im Anflug bedeutet Regen natürlich
eine Situation, bei der es nicht leicht ist, größere Strecken zu
überwinden. Trotzdem bleibt uns die Hoffnung nach wie vor erhalten,
bald Dauergäste am Nest begrüßen zu können.
Lassen Sie mich dafür heute
einen weiteren Eintrag im Gästebuch zum Anlass nehmen (wir haben ja
Zeit!), einen Teilaspekt aus der Brutbiologie der Störche zu
bearbeiten. Die Schreiberin fragt, ob Störche auch im Wald
brüten? Wenn sie ihre Frage auf den Weißstorch bezieht (also auf
die Vogelart, auf die wir in Dinkelsbühl zur Zeit sehnsüchtig
warten), lässt sich die Frage schnell mit einem ziemlich
eindeutigen „Nein“ beantworten.
Unter den weltweit 17 Arten aus der Familie der Störche sind alle
ausnahmslos Baumbrüter. So brütete unser Weißstorch ursprünglich
auf Bäumen, so wie er es heute auch noch in weiten Teilen seines
Verbreitungsgebietes zu tun pflegt (dann brütet er doch im Wald, da
stehen doch die Bäume!). Vor allem im Osten (Russland, Polen, in
den baltischen Staaten) seines Verbreitungsgebietes entfallen hohe
Prozentzahlen auf das Brüten auf Bäumen. In Deutschland gehört
diese ursprüngliche Nistweise zu den Ausnahmen. In Bayern steht
momentan meines Wissens von gut 100 Nestern ein einziges auf einem
Baum und hier hat der Mensch auch etwas nachgeholfen, indem er den
Baum köpfte und auf dem „Rest“ eine Nisthilfe anbrachte. Bei
allen Baumbruten handelt es sich meist um einzeln oder in lockeren
Verbänden stehende Bäume, wie sie in der Talaue großer Ströme
teilweise noch existieren.
Solche Auwälder, die in immer geringerem Umfang größere Flüsse
begleiten, sind noch gelegentlich Niststätten für Meister Adebar.
Die größte Kolonie dieser Art befindet sich derzeit im Grenzgebiet
zwischen Österreich und der Slowakei an der March (Grenzfluss
zwischen beiden Staaten) bei Marchegg. Hier brüten in einer Kolonie
etwa 60 Paare des Weißstorchs meist auf Eichen. Eine Webcam
überträgt in diesem Jahr wieder Livebilder
aus einem dieser Nester.
Nachdem in den Auen der Flüsse immer weniger Bäume stehen blieben, die
von ihrer Größe und Beschaffenheit für den Weißstorch geeignet
schienen, suchten sich die Brutinteressenten andere hohe Strukturen
und erschlossen sich bald den Wohnbereich des Menschen mit seinen
oft hohen Gebäuden. So kamen Kirchtürme, Kamine, Tore von
alten Stadtbefestigungen, Schlossanlagen, Brauereigebäude kurzum
alles , was aus einer Stadtsilhouette mal mehr oder weniger
herausragt, hinzu. In neuerer Zeit macht Adebar auch vor modernen Industriebauten
nicht Halt und brütet auf Fabrikschornsteinen und
Silotürmen, um nur einige Beispiele zu nennen. Auch auf dem
Dach eines Jägerstandes, inmitten eines Kieswerkes oder einer frei
stehenden Feldscheune wurden in Bayern bereits erfolgreiche Bruten
nachgewiesen, was die große Anpassungsfähigkeit des Weißstorchs
dokumentiert. Zum großen Renner jedoch entwickeln sich mehr und
mehr die Nester auf Masten aller Art. Vor allem auf
Holzmasten im Niederspannungsbereich innerhalb von Ortschaften kommt
es zu immer mehr Ansiedlungen. Diese erfolgen teils spontan – ohne
menschliches Zutun, teils werden vom Energieversorger eigens für
den Storchenzweck Masten aufgestellt, die nur noch die Funktion als
Nestunterlage erfüllen. So stehen in Ungarn beispielsweise 71%
aller Nester auf Masten, in Lettland sind es bereits 43% mit weiter
steigender Tendenz.
|

|
Spontan errichtetes Nest auf Mast im
Niedrigspannungsbereich. Das Paar verließ nach Bauarbeiten den
potentiellen Brutplatz |
Ein Wald – wie ihn sich die Gästebuchschreiberin bei ihrer
Frage vielleicht vorgestellt hat – gehört nicht in das
Biotopschema von Ciconia ciconia. Einmal die Flügelspannweite von
rund 2 Metern sowie die nicht sehr ausgeprägte Wendigkeit des
Fluges verhindern schon allein deshalb ein Manövrieren in dicht
bewaldetem Gelände. Ein naher Verwandter von C.ciconia und
gleichzeitig auch seltener Brutvogel in Deutschland (man rechnet auf
dem Gebiet der Bundesrepublik mit einem Bestand von gut 300 Paaren
– Tendenz steigend) ist C. nigra – besser bekannt unter dem
Namen Schwarzstorch.
 |
 |
Durchziehender
Schwarzstorch am
27.März 2001 an der Wörnitz bei Dinkelsbühl |
Da er auch als Waldstorch bezeichnet
wird, ergibt sich schon seine Vorliebe für den Wald – auch als
Standort seines Nestes. Dieser Storch bewohnt immer noch – obwohl
sich in den letzten Jahrzehnten eine Änderung anbahnt – Gebiete,
die weit ab menschlicher Siedlungen liegen und den Wald einschließen.
So baut er sein Nest in die Astgabelungen alter, hoher Bäume,
soweit sie nicht allzu weit weg von stillen, an Gewässer reichen
Flusstäler und anderer „Feuchtbiotope“ liegen. Seine große
Wendigkeit beim Flug, der nicht so ausschließlich auf den Segelflug
ausgelegt ist wie beim Weißstorch, erlaubt es dem schwarzen Vetter
unseres Kamerastars, in störungsarmen Waldgebieten zu brüten. So
sind in Bayern Brutpaare in den östlichen Landesteilen und in
einigen Mittelgebirgsregionen bekannt. Eine deutliche Tendenz einer
Ausbreitung nach Westen ist dabei seit geraumer Zeit feststellbar.
Wer dem Waldstorch beim Brüten zusehen und viel über seinen Zug
erfahren will, sei auf die tschechische Website Africká
Odysea verwiesen.
|
|
14. Apr. 02
|
Ein weiterer Tag des Wartens
neigt sich seinem Ende zu und es ist bereits eine Woche her, dass
die beiden letzten Nestbesucher gesichtet wurden. So bleibt mir
abermals Zeit, einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen
und Sie mit unseren Planungen ein wenig vertraut zu machen. Über
deren Fortgang werde ich Sie natürlich auf dem Laufenden halten.
Wesentlicher Teil der
Storchenarbeit ist der Schutz und die Optimierung des Lebensraumes.
So stellt nach meiner Einschätzung das Gebiet um Dinkelsbühl
keinen optimal ausgestatteten Lebensraum dar, auch wenn in den
vergangenen Jahren Brutpaare Junge zum Ausfliegen brachten. Während
der vergangenen 9 Brutjahre ergibt sich bei 13 ausfliegenden Jungstörchen
lediglich ein Durchschnittswert von 1,44 Jungen pro Jahr. Nicht nur
aus diesem Grund wurde in den vergangenen Monaten der Lebensraum
nach möglichen Verbesserungen durchgecheckt und die ersten
Planungen ins Auge gefasst. In der nächsten Stufe sollen dann in
Zusammenarbeit mit Eigentümern bestimmter Flächen, mit
Naturschutzverbänden sowie mit dem Landschaftspflegeverband
Mittelfranken Maßnahmen, die der Verbesserung des
Lebensraumes dienen, umgesetzt werden. Ich werde Ihnen – wenn
alles spruchreif ist – die
Projekte dann in Wort und Bild vorstellen, die Vorhaben erläutern
und Sie dann von Fall zu Fall bitten, diese Arbeit durch eine Zuwendung
auf unser Spendenkonto zu unterstützen. Ich werde Sie also
nicht ohne Grund um eine Spende bitten. Es bleibt Ihnen trotzdem
vorbehalten, auch einfach so und wegen der hoffentlich guten Sache,
schon jetzt unser Konto zu belasten. Ich versichere Ihnen, dass mögliche
Gelder sinnvoll für die Storchenarbeit verwendet werden.
Hoffentlich denken Sie jetzt nicht: Nun hat der Gauner viele
Tagebucheinträge verfasst und jetzt kommt er mit dieser Masche! Hab
ich mir's doch gleich gedacht! Die sind wie alle! Sie haben es doch
nur auf unser Geld abgesehen!
Ich kann jeden verstehen, der
so denkt und ich bin ihm deshalb auch überhaupt nicht böse. Ich
appelliere bei meiner Bitte an die, die ihr Engagement und ihre
Verbundenheit mit dem Gesamtpaket „Schutz der Natur“ in dieser
Weise bekunden wollen. Auch kleine und kleinste Eurobeträge sind es
wert, zum Einsatz gebracht zu werden. Im vergangenen Jahr wurden
insgesamt 2.720 DM gespendet, über die wir sehr froh waren. Es
musste die Videokamera gekauft und ein wenig in andere Technik
investiert werden. Dafür waren in etwa 4000 DM zu berappen. Wegen
der Ehrenamtlichkeit der Mitarbeiter – ich erwähne hier ausdrücklich
Herrn Andreas Kamm von K & K Computer Systeme und Herrn Helmut
Wilfling – konnten die Kosten so niedrig gehalten. Die Männer der
Technik übernehmen die Gebühren für die Telekom und leisten somit
eine große finanzielle Unterstützung. Ebenso berechnet Ihr
Storchenexperte für die Zeit des Beobachtens, Schreibens und
Recherchierens keinen Pfennig. Ebensolches gilt für den Webmaster
Herrn Wolfgang Horlacher, der alles immer so schnell und in einem
vorzüglichen Layout ins Netz stellt. Ihre positiven Reaktionen
geben uns deshalb weiter Mut, Sie nicht im Stich zu lassen und
weiter über alles informieren zu wollen. Unser neuer Sponsor
N-ERGIE – er geht die Absicherung gefährlicher Strommasten mit
Vehemenz an – unterstütze unsere Arbeit zu Jahresbeginn mit 2500
Euro, so dass damit die anfallenden Kosten für den Betrieb und die
Wartung der Webcam abgedeckt sind. So wollen wir vorerst auf eine
bessere Technik verzichten, Ihnen dafür nur Bilder im
10-Sekunden-Takt zumuten und das Hauptgewicht der Arbeit in den
Lebensraum legen und dafür auch Ihre möglichen Zuwendungen zum
Einsatz bringen.
|
|
15. Apr. 02
|
Am Nest zeigt sich die
Situation unverändert. Kein Storch, wenig Dohle, Nestzustand
stabil, kein Grund zur Besorgnis, Geduld aufbringen, wir
haben ja noch Zeit!
Zum Zug der Störche haben oder
werden Sie sicher noch häufiger die Website www.storchenzug.de
anklicken, um die besenderten Störche den restlichen Weg nach Hause
zu begleiten. Prinzesschen – einer der Senderstörche - hat die
vergangene Nacht in der Slowakei verbracht, während der zweite
Senderstorch, Felix, nur
wenig Rückstand aufweist und an der ungarisch-slowakischen Grenze
übernachtete. Dies bedeutet, dass beide bald ihre Brutheimat im
Osten Deutschlands erreichen.
Dass Störche überhaupt den weiten Zug zweimal im Jahr auf sich nehmen,
hat seinen Ursprung im Wechsel von Eiszeiten und anschließenden
Warmzeiten. Nach der letzten Eiszeit, in der große Flächen
Mitteleuropas von Eis bedeckt waren und auch die südeuropäischen
Gebiete eine viel niedrigere Jahresdurchschnittstemperatur aufwiesen
als heute, eroberten sich die Weißstörche neue Brutgebiete weiter
nördlich ihrer ursprünglichen subtropischen Heimat. Diese
Entwicklung verlief nicht schlagartig, sondern entstand über
Jahrtausende und kam und kommt auch heute nicht zum Stillstand. So
eroberten sich die Vögel neue Brutgebiete, die sie dann – bedingt
durch die in nördlicheren Breiten existenten Jahreszeiten und die
damit verbundene Nahrungsknappheit in den Wintermonaten räumen
mussten. Der Vogelzug war die Folge – ein periodischer Rückzug
aus dem unwirtlichen Brutgebiet in die ursprüngliche Heimat. Diese
Bewegungen verlaufen auch noch heute so, obwohl die letzte Eiszeit
bereits vor etwa 10.000 Jahren ihr Ende nahm. So besiedeln die Weißstörche
zurzeit immer noch neue Gebiete in Russland und haben in den letzten
Jahrzehnten ihr Brutgebiet bis östlich von Moskau sowie an die
russisch-finnische Grenze ausgedehnt.
Viele Vögel verfügen – bei Grasmücken wurde dies experimentell von
der Gruppe des Professors Dr. Peter Berthold aus Radolfzell
experimentell nachgewiesen – über eine endogene Jahresperiodik.
Das heißt, Vögel entwickeln in Zugzeiten eine hormonell
gesteuerte Unruhe, die von einer zunehmenden bzw. abnehmenden Tageslänge
beeinflusst wird. Darüber hinaus ist die Zugrichtung genetisch
fixiert sowie die Dauer des Hormonflusses auf die Zeitspanne
begrenzt, die für das Erreichen des Winterquartiers benötigt wird.
Auf Störche übertragen bedeutet dies: Mit abnehmender Tageslänge
beginnt im Vogelkörper ab Ende August ein Hormon zu fließen, das
eine gesteigerte Unruhe auslöst. Diese Unruhe führt letztlich zum
Verlassen des Brutgebietes. Bei einer vermuteten Dauer des
Hormonflusses von rund vier Wochen sowie der genetisch fixierten
Abflugrichtung erreichen die Störche dann nach 3 bis 4 Wochen Zug
ihr Winterquartier. So wäre der wissenschaftliche Ansatz. Doch längst
nicht alle Störche halten sich an wissenschaftliche Erkenntnis und
tun auch das, was sie wollen. Aber im Idealfall verliefe der Zug so
wie dargestellt. Die mitteleuropäischen geografischen Gegebenheiten
bringen jedoch so manche Schwierigkeit im Zuggeschehen mit sich. Ein
direkter Flug nach Süden verbietet sich für einen Großteil der
deutschen Storchenpopulation schon allein durch das Vorhandensein
der Gebirgsbarriere Alpen. Die zweite Problematik betrifft
die große Wassermasse des Mittelmeeres, die freiwillig
ebenso wenig von Meister Adebar überflogen wird (fehlende Thermik
über dem kalten Wasser im Vergleich zur wärmeren Landmasse).
Bayrische und speziell die fränkischen Störche – also auch die
Dinkelsbühler – sitzen nun quasi zwischen den Stühlen: Wenn sie
die Alpen meiden und das Mittelmeer umgehen wollen, ergeben sich
zwei Möglichkeiten: Ein Abflug Richtung Südwesten oder Südosten.
Je weiter westlich einer gedachten, durch Bayern laufenden Linie Störche
brüten desto ausschließlicher fliegen sie nach Südwesten ins
Winterquartier ab. Je weiter östlich von Bayern die Adebare
beheimatet sind desto wahrscheinlicher ist ihr Abzug nach Südosten.
Auf beiden Zugrouten gibt es je eine Stelle, an der das Mittelmeer
einigermaßen gefahrlos überquert werden kann. Im Westen die
Meerenge von Gibraltar, auf der Ostroute die Gewässerzone um
Istanbul in der Türkei. Die eigentlichen Winterquartiere liegen
schließlich in Westafrika zwischen dem Senegal und Nigeria für die
Westzieher bzw. im Sudan an den Gestaden des Nils und seiner Nebenflüsse
bis in den Tschad für die Ostzieher. Beide mehr oder weniger als
Endziele zu bezeichnenden Gebiete werden (Satellitentelemetrie sei
Dank!) von den Störchen in drei bis vier Wochen Flug erreicht (so
lange fließen auch besagte Hormone!). Dass gerade bei den
Ostflieger nach der ersten Station im Sudan und Umgebung ein
Weiterflug nicht selten erfolgt und bis an die Südspitze Afrikas führen
kann, hängt mit der Suche nach neuen Nahrungsquellen zusammen. Ein
weiteres Vordringen der Weststörche nach Süden ist wegen der
Grenzwirkung des ausgedehnten Regenwaldgürtels nicht möglich, so
dass für diese Teilgruppe der Überwinterer bei Nahrungsengpässen
wenig Alternativen bestehen. Im letzten Jahrzehnt hat sich jedoch
eine entscheidende Veränderung im Zugverhalten der sogenannten
„Weststörche“ angebahnt, deren Ende noch nicht absehbar ist.
Ein nicht unerheblicher Teil der besenderten schweizerischen und
belgischen Weißstörche – über deren Aufenthalt man also ganz
genau Bescheid weiß – verbringen die Wintermonate bereits im Süden
Spaniens und überqueren die Straße von Gibraltar nicht mehr. Etwa
die Hälfte der angesprochenen Störche wählte in den vergangenen
Jahren diese energiesparende Lösung. Bei einer Generationenfolge
von 5 bis 6 Jahren dauert es beim Storch sicherlich einige Zeit, bis
eine neue Zugstrategie auch genetisch verankert ist, aber dieser
Prozess scheint doch schon voll im Gange zu sein. Bei den oben schon
erwähnten Mönchsgrasmücken, die eine schnellere, nur einjährige
Generationenfolge aufweisen, sind derartige, auf eine Klimaerwärmung
zurückgehende Veränderungen im Erbgut bereits nachgewiesen. Dass
sie ihre ehemaligen Winterquartiere im Süden Europas und im
Nordteil Afrikas mit einem neuen Winterquartier im atlantisch geprägten
Großbritannien eingetauscht haben, ist bereits genetisch fixiert
und ein Beweis für die vielleicht nur 50 Generationen dauernde
Umpolung einer Zugstrategie. Bahnt sich beim Weißstorch Ähnliches
an und sind wir vielleicht schon mitten in dieser Entwicklung? Ein weiterer
Teil zum „Zug“ der Störche erscheint bei Bedarf in einem
der nächsten Tagebucheinträge.
Es sei denn, die Dinkelbühler Störche.....????
|
|
16. Apr. 02
|
Wie wir ja bereits seit einigen
Jahren durch die Besenderung von mittlerweile über 100 Weißstörchen
wissen, läuft der gesamte Zug – von ungünstigen Witterungsverhältnissen
abgesehen – sehr zügig. Die dabei zurückgelegten Tagesetappen
sind im Durchschnitt des drei- bis vierwöchigen Zuggeschehens bei
etwa 250 Kilometern anzusetzen. Spitzenwerte von bis zu
500 Kilometern sind nachgewiesen, diese Glanzleistungen
passieren jedoch vor allem im außereuropäischen Teil des Zuges.
Dort herrschen im September bzw. im März deutlich höhere
Temperaturwerte als in Mitteleuropa, so dass die thermischen
Gegebenheiten in dieser Zeit ein längeres Segelfliegen
erlauben. So arbeiten sich die Störche nach dem Aufbruch am Morgen
eines Zugtages in einem Thermikschlauch in die Höhe, um dann im
Gleitflug eine bestimmte Strecke zurückzulegen. Der dabei
auftretende Höhenverlust muss dann immer wieder durch das Suchen
einer neuen Thermik ausgeglichen werden usw. Störche und andere
Segelflieger arbeiten sich in dieser Flugtechnik voran. Als Leitlinien
des Zuges dienen markante Flusstäler, bestimmte Passeinschnitte bei
Gebirgsübergängen, Küstenlinien und ähnliches. Die letzte
Strecke des Weges – man nähert sich z.B. wieder Bayern – wird
dann visuell nach gespeicherten Geländemarken quasi aus der
Erinnerung angesteuert. So kommt es vor, dass Störche ihr Brutnest
aus dem Vorjahr wiederfinden und als solches auch aus der Luft
wieder erkennen. Auf Grund der Ergebnisse, die die
Satellitentelemetrie bisher erbrachte – und es gibt darunter
einige Störche, die ihre Sender über vier Brutjahre trugen – weiß
man, dass die einmal gewählte Flugrichtung – also
beispielsweise Abflug nach Südost
(Ostzieher) - zeitlebens beibehalten wird. Die auf
dieser Route gewählte Strecke kann sich hingegen deutlich von Jahr
zu Jahr unterscheiden, wobei Abweichungen um 100 bis 200 Kilometer
von der Strecke des Vorjahres möglich sind. Auch hinsichtlich des
eigentlichen Überwinterungsgebietes gibt es individuelle Unterschiede.
Einige wählen in jedem Winter die gleiche Region, andere verbringen
das Winterhalbjahr alljährlich in einem anderen Gebiet, das aber
geografisch nicht extrem von dem des Vorjahres entfernt ist. Dieses
Verhalten gilt ebenso für die Westzieher, wie es auch für die fränkischen
Störche Gültigkeit hat, die ja beide Möglichkeiten des Zuges
offen haben. Die genetische Fixierung „erlaubt“ dem Storch
jedoch nur eine Möglichkeit. Nun soll man ja in der
Storchenforschung nichts ausschließen: So könnte es theoretisch möglich
sein, dass ein Ostzieher über den Sudan in den Tschad gerät
(Belege dafür sind zahlreich vorhanden). Ebenso ist es einem Westzieher
möglich, auf der Westroute bis in den Tschad zu gelangen (auch
hierfür gibt es eine Reihe von Ringfunden). Nun stehen also in
diesem zentralafrikanischen Land zwei Störche nebeneinander, die
auf völlig verschiedenen Wegen dorthin gelangten. Da ist es doch
weiterhin durchaus vorstellbar, dass sich einer dem jeweils anderen
oder den jeweils anderen anschließt und für den Rückflug eine
andere Route wählt, also einen Schleifenzug vollführt: Hinweg über
Gibraltar, Westafrika, Tschad, Treffen auf Ostzieher, Rückweg
Sudan, Ägypten, Türkei, Europa. Beweise für diese Möglichkeit
liegen bisher noch nicht vor, vielleicht lässt sich einer der
kommenden Satellitenstörche einmal zu einer solch gedachten Reise
überreden.
Erfahrene Störche, die schon
mindestens eine Brutzeit hinter sich haben, suchen im nächsten Jahr
bevorzugt das alte Brutnest wieder auf. Jedoch ereignen sich
zahlreiche Unglücksfälle auf dem Zug, so dass längst
nicht alle Störche wieder ans alte Nest zurückkommen. In
Dinkelsbühl war das in der Vergangenheit die Regel. Wechsel
ereigneten sich häufiger als dass Kontinuität vorherrschte.
Alle diesjährigen Besucher
des Dinkelsbühler Nestes (es waren schon 11 verschiedene Gäste)
befanden sich quasi auf der Suche nach einem Nest. Der eine nutzte
das Nest als Lande- und kurzzeitigen Ruheplatz auf dem Weg zu seinem
eigentlichen Brutnest, wieder andere kamen auf ihrem Weiterflug mal
eben vorbei. Keiner hatte das Nest vorher schon einmal gesehen, aber
die Biotopstruktur um Dinkelsbühl passt noch ganz gut in das
angeborene Biotopschema von Meister Adebar und so führt diese
Tatsache immer wieder Störche auf dem Zug oder auf der Suche nach
einem Nest dorthin. Dass ein Nest vorhanden ist, verstärkt
allenfalls die Affinität zu diesem Ort. Dabei spielt es keine
Rolle, ob das Nest einen unordentlichen Eindruck macht. Dies ist
für viele Menschen vielleicht ein Kriterium, doch Störche
unterliegen anderen Zwängen als wir Menschen. So ist es viel
entscheidender, ob das Nestgebäude gute An- und
Abflugbedingungen bietet und die thermischen Gegebenheiten
um das Nest günstig sind. Störche rasten gerne auch auf Dächern,
ohne dass zunächst weit und breit ein Nest sichtbar wäre. Die
Besucher unseres Nestes waren also nur Suchende, die aus zunächst
unbekannten Gründen keine Absicht bekundeten, in Dinkelsbühl zu brüten.
Vielleicht waren einige noch gar nicht geschlechtsreif, andere auf
dem Weg in ihre eigentliche Brutheimat. Der Richtige war jedenfalls
noch nicht dabei. So werden auch in den nächsten Tagen oder Wochen
„Suchende“ bemerkt und unbemerkt die Wörnitz entlang ziehen und
über Dinkelsbühl kreisen. Sie müssen das Nest nicht kennen, aber
die Gesamtheit der Impulse, die der Lebensraum um die Stadt im Vogel
auslöst, lässt ihn dann weiter suchen und er wird das Nest – in
welchem Zustand auch immer – als solches erkennen und wenn er
will, wird er es auch benutzen und ausbauen.
Zugvögel – und auch
die Störche – brüten nicht in ihrem Winterquartier. Jedem
Vogel sind physiologische Grenzen gesetzt, die eine Brut nicht immer
und überall ermöglichen. Die Störche zum Beispiel brauchen für
Brut und Aufzucht der Jungen – wenn man für Nestbau und für die
Zeit vor dem Abzug auch noch drei Wochen einkalkuliert – gute vier
Monate Zeit. Danach geht für den Herbstzug noch einmal ein Monat
ins Land, der Frühjahrszug verschlingt mindestens einen weiteren
Monat, so dass schnell sieben Monate zusammenkommen, die von Stress
und übergroßer Forderung an den Organismus geprägt sind. Nach dem
Zug sind die Vögel nicht mehr in Brutstimmung, die Gonaden haben
sich zurückgebildet und der Körper kocht bruttechnisch auf
Sparflamme. Bei kleineren Vögeln – Schwalben zum Beispiel –
sind die Verhältnisse ähnlich. Manche haben bereits im Brutgebiet
die Zeit optimal genutzt und zwei Bruten zum Ausfliegen gebracht.
Der Zug ins zentrale Afrika erfordert eine Höchstbelastung. Dazu
kommt, dass Mauserzyklen – also die alljährliche Erneuerung der
Federn - ablaufen, die
den Organismus extrem belasten. Eine Brutzeit – und die in Europa
– ist also das höchste der Gefühle!
Seit etwa 50 Jahren brüten in
Südafrika in der Kapprovinz einige wenige Paare Weißstörche
auf Bäumen, seit einigen Jahren auch im Tygerberg Zoo in
Kapstadt. Wie diese besondere Brutvariante entstand, ist nicht mehr
nachvollziehbar. Vielleicht sind einmal ein paar europäische Weißstörche
im Winterquartier zurückgeblieben. Sie verpassten den Rückflug und
brüteten. Diese bequeme Art machte allerdings keine Schule, es
blieb bei Einzelbruten. Die Jungen dort sind so um die Jahreswende
flügge, also so wie bei uns im Hochsommer der Südhalbkugel. 2001
und 2002 wurden einige der südafrikanischen Weißstorchjungen mit
Sendern markiert, um über deren Zugwege etwas zu erfahren. So wie
es bis jetzt aussieht, hat noch keiner der Jungen den Äquator nordwärts
überflogen. Kenia blieb bisher die Endstation, eine Rückkehr mit
anderen europäischen Weißstörchen bis Europa scheint nicht zu
erfolgen, die „Ermittlungen“ laufen noch. (Siehe auch unsere Linkliste
Avian Demography Unit – Südafrika)
|
|
17. Apr. 02
|
Auch wenn ich mich zum x-ten
Male wiederhole: Es tut sich leider immer noch nichts am
Nest. Zum Zustand desselben erübrigt sich weiterer Kommentar.
Ich füge aber trotzdem einige Schnappschüsse der letzten Tage bei,
die zeigen sollen, dass der Verlust an Nestsubstanz zwar immer noch
fortschreitet, dies aber für die Akzeptanz eines Storchenpaares
sicher nur zweitrangig ist.
|

11.4. Mit vollem Munde (Schnabel) fliegt man nicht!
|

13.4. Angriff aus der Luft!
|

14.4.Nestplünderer
am Werk
|
|

16.4. Und dasselbe noch einmal
|

17.4. „Turteltauben“ ganz zärtlich!
|
|
Der erste Storch in
diesem Jahr verabschiedete sich am 16. März, obwohl damals das Nest
einen „ordentlichen“ und perfekten Eindruck abgab und mit dem
Vetschauer Nest und den anderen Kameranestern konkurrieren konnte.
Also konnte es seinerzeit nicht am Nest gelegen haben so wie es
heute auch nicht daran liegt. In den vergangenen Dinkelsbühler
Brutjahren kamen die Störche häufig erst um Mitte April oder später.
Zwei der besenderten Oststörche waren gestern in Polen und
kommen in diesen Tagen in ihre Brutheimat. Es tut sich also schon
noch etwas. Da von den fünf Brutpaaren an der Wörnitz innerhalb
des Landkreises Ansbach bereits vier komplett sind, müssen ja alle
Neuankömmlinge in Dinkelsbühl vorbeischauen.
|
|
18. Apr. 02
|
Unser Nest präsentiert sich
nach wie vor einsam und verlassen. Die Dohlenbesuche erfolgen
mit weiterhin abnehmender Tendenz, das Taubenpärchen hat
wieder intensiv geturtelt und es sogar bis „zum Äußersten“
getrieben. (Hierfür fehlt leider der fotografische Beweis). Ein
neuer „halber“ Nestbesucher – er ließ sich etwa zwei Meter
von der Storchenbehausung entfernt an der Spitze des Dachfirstes
nieder – tauchte vor der Kameralinse auf: Eine Elster!
Dieser mit den Dohlen verwandte Rabenvogel schwebte für einige
Sekunden ein, um anschließend zu seinem kugelförmigen Nest in der
äußersten Spitze einer Pappel zu eilen.
Heute gelang noch eine weitere Erstbeobachtung
einer Vogelart im Storchennest. Für kurze Zeit machte eine Bachstelze
– ihr Name sagt nicht alles über ihren Aufenthaltsort aus –
dort Station.

Einzeldohle auf
Nistmaterialklau |

Küsschen gefällig? Und
dann geht´s zur Sache! |

Neuer „halber“ Nest-
besucher - die Elster |

Die
erste Bachstelze
im Storchennest |
Es gibt also nach wie vor
– ein bisschen Geduld vorausgesetzt – kleine Highlights
um die Storchenkamera.
|
|
19. Apr. 02
|
Es lohnt sich, einmal ganz
schnell auf die Ereignisse um die anderen Webcamnester
einzugehen.
In Vetschau (www.storchennest.de)
kam es gestern bis in die Abendstunden zu erbitterten Storchenkämpfen.
Dabei wurde mindestens ein Ei aus der Nestmulde geworfen und
kullerte an den Nestrand. Im Verlauf der Kämpfe scheint sich meiner
Meinung noch mehr ereignet zu haben. Möglicherweise kam es auch zu
einem Partnerwechsel. Denn seit den Kämpfen kommt es wieder regelmäßig
zu Kopulationen, außerdem wird längst nicht mehr mit so viel Zug
gebrütet und mindestens einmal verließen heute Abend beide Partner
gemeinsam das Nest. Zwar nur für wenige Minuten, aber das tun sie
eigentlich nur, wenn etwas nicht stimmt, wenn keine Eier im Nest
liegen oder irgendeine Gefahr im Verzug ist. Gelegeübernahme durch
fremde Störche kommt nicht vor, die neuen werfen alle Eier aus dem
Nest. Da aber noch mindestens ein Ei in der kleinen Nestmulde liegt,
muss es dafür doch andere Gründe geben. Auf alle Fälle ist eine
erfolgreiche Brut in Vetschau zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch
keinesfalls gesichert.
Die Webcam in Pamhagen (www.storch.at)
liefert selten ein Bild. Das seit Ende März anwesende Paar brütet
allerdings (noch) nicht.
Einen Tipp wert (wenn auch ohne
jegliche Hintergrundinfos) ist auf alle Fälle die Webcam unter http://panda.wwf.at/storchlive.html.
Das dortige Baumbrüterpaar in der Nähe von Marchegg in Niederösterreich
versucht, fünf Eier auszubrüten.
In Ribe (www.ribe.dk)–
Dänemark – kann ab und zu der erste anwesende Storch im Nest
beobachtet werden, ansonsten sieht man nicht sehr viel : Seitlicher
Blick zum Storchennest und relativ großer Abstand.
In Rathenow (www.nabu-rathenow.de/kam.htm)
hat sich ein Paar angesiedelt. Die Kamerabilder und die
Hintergrundinformationen sind wenig überzeugend bzw. spärlich
(dies soll keine Kritik sein, jede Bemühung in unserer Sache ist
deshalb anerkennenswert.).
Alle anderen mir bekannten oder
unter unseren Storchen-Links aufgeführten Websites sind momentan
noch ohne Storch bzw. sie liefern (noch) keine Bilder.
Heute um 18:00 Uhr hatte ich
nach längerer Zeit wieder einmal eine Begegnung mit Freund
Adebar in der Nähe von Dinkelsbühl. In einem nur spärlich mit
Wasser gefüllten Weiher zwischen Maulmacher und der Froschmühle
suchte ein unberingter Storch nach Weißfischen und erbeutete in der
Zeit, in der ich beobachtete, auch einige Exemplare. Er flog dann
aus dem kleinen Teich heraus und ging in den angrenzenden Wörnitzwiesen
weiter auf Nahrungssuche.

Da sehe ich doch noch einen Weißfisch!

Auch einige Rabenkrähen wissen, wo es etwas zu Fressen gibt

Jetzt raus hier und ab auf die Wörnitzwiese!
Zum Dinkelsbühler Nest betrug die
Entfernung knappe zwei Kilometer. Da sich aber dort bis zum Einbruch
der Dunkelheit auch heute kein Storch blicken ließ, hatte ich einen
anderen Verdacht. Könnte es nicht der Storchenmann aus Mosbach
– also unser Ex-Dinkelsbühler Storch – sein? Einen Beweis für
den Aufenthalt an dieser Stelle, etwa 9 Kilometer vom Mosbacher Nest
kann ich diesmal nicht erbringen. Beim Weibchen gelang dies ja kürzlich
an fast gleicher Stelle auf eindrucksvolle Weise (siehe
Tagebucheintrag vom 3.April). Ich begab mich, während der fragliche
Storch weiter bei Dinkelbühl Regenwürmer fraß, schnell nach
Mosbach und eine knappe Viertelstunde später saß ich bereits auf
meinem Beobachtungsposten auf dem dortigen Kirchturm. Ein Storch lag
brütend in dem riesig frisch ausgebauten Nest. Ein heftiger
Regenschauer peitschte gerade über die kleine Ortschaft hinweg.
Doch nach einer halben Stunde erhob sich der Brüter. Es war das
beringte Weibchen. Nach dem Wenden von mindestens drei Eiern, ließ
es sich vorsichtig zum Weiterbrüten auf dem Gelege nieder. Diese
Beobachtung bestärkte in mir den gehegten Verdacht: Der Storch, den
ich gerade vor den Toren Dinkelsbühls ausgemacht hatte, muss mit
fast 100%-iger Sicherheit der Partner der Mosbacher Storchendame
gewesen sein. So besuchen also beide Alt-Dinkelsbühler Störche
auch weiterhin ihre alte Heimat wenigstens zur Nahrungssuche. Eine
sicher erstaunliche Beobachtung, liegt doch die große Entfernung zu
diesem Nahrungsgebiet weit außerhalb der nach Lehrmeinung gültigen
Kilometerangaben von max. 3-5 Kilometern.
|
Thomas
Ziegler
|